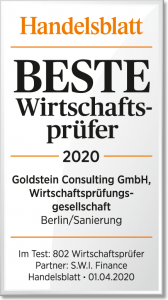| |
|
| |||
|
| |
Oktober 2020 , |
|
|
| |
Ab 2021 müssen viele Steuerbürger keinen Soli mehr abführen – für 2020 aber sehr wohl. Das bestätigte das FG Nürnberg im Fall eines selbständig tätigen
Ehepaars aus Bayern. Die Eheleute hatten gegen die Vorauszahlung des Solis für dieses Jahr geklagt, weil sie ihn für verfassungswidrig halten. Der Solidaritätszuschlag sollte eigentlich im Rahmen des coronabedingten Konjunkturpakets abgeschafft werden. Doch die Bundesregierung konnte sich nicht einigen. Nun kommt die Abschaffung erst zum 1.1.2021 für ca. 90 % der Steuerzahler. Der Soli wurde 1995 durch das Solidaritätszuschlagsgesetz als „Ergänzungsabgabe“ zur Einkommen- und Körperschaftsteuer unbefristet in Kraft gesetzt. Er fließt komplett in den Bundeshaushalt und sieht keinerlei Zweckbindung vor. Das Gesetz wird allerdings politisch mit dem „Solidarpakt II“ und den Finanzhilfen für die neuen Länder verbunden. Die Gegner des Solis sehen mit dem Auslaufen des Solidarpakts II seit Ende 2019 keine Rechtfertigung mehr für den Solidaritätszuschlag, der vor allem als Aufbauhilfe für Ostdeutschland dienen sollte. Ab 2021 sollen diesen nur noch Spitzenverdiener zahlen müssen. Die Teil-Abschaffung steht im Kreuzfeuer der Kritiker. Das Finanzgericht gab dem Finanzamt im Wesentlichen Recht und sah auch keinen Anlass, den Soli dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Dennoch entschieden die Richter in einem Teilaspekt wegen eines Rechenfehlers des Finanzamts zugunsten des Ehepaars. Das Amt hatte die ab 2021 geltenden Änderungen bei der Festsetzung der Höhe der Vorauszahlungen nicht berücksichtigt. Die Richter ebneten den Klägern aber den Weg zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache. Damit wird der Zuschlag jetzt von zwei Seiten in die Zange genommen, denn einige FDP-Bundestagsabgeordnete haben nun gegen die Ergänzungsabgabe auch Verfassungsbeschwerde beim BVerfG in Karlsruhe eingelegt. Klageführer sind u. a. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr und vier weitere FDP-Abgeordnete. Die Beschwerdeführer fordern die Feststellung der Verfassungswidrigkeit rückwirkend ab Januar 2020. Unser Rat: Sofern kein Vorläufigkeitsvermerk vorliegt, werden wir gegen entsprechende Bescheide Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen. Bei Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung (AdV) droht jedoch die Gefahr einer Zinspflicht in Höhe von 6 %, sollten die Verfahren negativ ausgehen. |
|
|
| |
Die Sanierung des WC ist beim Homeoffice O. K.Schon vor Ausbruch der Coronakrise war die Vermietung eines Homeoffice an den Arbeitgeber ein probates Mittel für Arbeitnehmer zur Umgehung der steuerlichen Einschränkungen beim häuslichen Arbeitszimmer. Der Hintergrund:
Ist das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit, dürfen Sie max. 1.250 € für ein häusliches Arbeitszimmer ansetzen, falls sie beim Arbeitgeber nicht über einen eigenen Arbeitsplatz verfügen. Ist ein solcher vorhanden, gehen Sie beim Werbungskostenabzug in der Regel völlig leer aus. Wird jedoch ein separater Mietvertrag geschlossen, können – unabhängig vom Arbeitsverhältnis – Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vorliegen, so dass die auf das Homeoffice entfallenden fixen und laufenden Kosten in voller Höhe abzugsfähig sind. Die Frage, in welchem Umfang bei diesem Vermietungsmodell die Kosten einer behindertengerechten WC- und Badrenovierung als Werbungskosten zu berücksichtigen sind, musste vor einiger Zeit das FG Köln entscheiden. Die Richter hielten lediglich die Aufwendungen für die Anschaffung eines WC nebst Waschbecken sowie Handtuchhalter und Seifenspender usw. für angemessen. Die darüber hinaus geltend gemachten Kosten, insbesondere für die Dusche und die Badewanne, könnten keine Berücksichtigung finden. Der BFH stellte im Revisionsverfahren eine andere Hürde auf, indem er eine Gewinnprognose fordert. Das bedeutet: Während der Vermietungsphase müssen die Einnahmen größer als die Ausgaben sein. Sehr hohe Renovierungskosten können diesen Nachweis natürlich erschweren. Fällt die Überschussprognose aber positiv aus, sind die gesamten Aufwendungen in vollem Umfang als Werbungskosten abzugsfähig. Wichtig: Falls Sie den Mietvertrag mit der Firma vor dem 1.1.2019 abgeschlossen haben, gelten Erleichterungen. Dann kann die Einkünfteerzielungsabsicht laut einem BMF-Schreiben weiterhin ohne Überschussprognose unterstellt werden. Auch zur Frage des Vorsteuerabzugs bei einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung an den Arbeitgeber hat sich der BFH geäußert: Danach muss zwischen dem Eingangsund Ausgangsumsatz ein unmittelbarer Zusammenhang vorliegen. Im Falle einer Bürotätigkeit kann sich die berufliche Nutzung des Homeoffice auch auf einen Sanitärraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer. Hinweis: Betragen Ihre Mieteinnahmen (und sonstigen umsatzsteuerpflichtigen) nicht mehr als 22.000 €, so kann die Vermietung des Arbeitszimmers an den Arbeitgeber umsatzsteuerfrei bleiben. Unser Rat: Ein schriftlicher Mietvertrag alleine genügt der Finanzverwaltung nicht, um das Modell wasserdicht zu machen. Entscheidend für die Anerkennung des Homeoffice- Mietvertrags ist, ob dieser vorrangig im Interesse des Arbeitgebers erfolgt ist. Andernfalls sind die Zahlungen als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Wir beraten Sie hierzu gerne. |
|
|
| |
Übernahme von Arbeitnehmeranteilen zur SV als ArbeitslohnBeiträge zur Sozialversicherung (SV) wie Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden vom Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN) gemeinsam getragen. Der vom AN zu tragende Beitragsanteil wird Arbeitnehmeranteil genannt. Sie führen für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens diesen Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag ab, Ihre Beschäftigten bleiben aber Schuldner ihres Anteils. Das bedeutet: Übernehmen
Sie neben dem Arbeitgeberanteil auch den Arbeitnehmeranteil, führt das zum Zufluss von steuer- und beitragspflichtigem Arbeitsentgelt bei Ihren Mitarbeitern. Doch was ist, wenn Sie Sachzuwendungen für alle Mitarbeiter pauschal mit 30 % zzgl. Kirchensteuer und Soli nach § 37b EStG versteuert haben und irrtümlich davon ausgegangen sind, dass es sich bei diesen pauschal versteuerten Sachzuwendungen nicht um sozialversicherungspflichtiges Entgelt handelt? Exakt diesen Fall hat aktuell das Finanzgericht Köln entschieden und klargestellt, die Übernahme von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung aus sozialversicherungsrechtlichen Summenbescheiden stelle keinen Arbeitslohn dar. Im Urteilsfall besteuerte ein Konzern Sachzuwendungen im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen pauschal nach § 37b EStG und ging fälschlicherweise davon aus, dass es sich bei diesen pauschal versteuerten Sachzuwendungen nicht um sozialversicherungspflichtiges Entgelt handelte. Um eine einheitliche sozialversicherungsrechtliche Behandlung pauschal versteuerter Sachzuwendungen an Arbeitnehmer herbeizuführen, bestand mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) eine schriftliche Vereinbarung, wonach die Sozialversicherungsbeträge nicht individuell den betroffenen Lohnkonten zugerechnet werden, sondern über einen pauschalierten Summenbescheid erfolgten. Dieses Verfahren ermöglicht es der Rentenversicherung, beispielsweise im Rahmen einer Betriebsprüfung, die Beiträge zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung im Schätzungsweg zu erheben, sofern die Höhe der Arbeitsentgelte nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden kann. Gleiches gilt, sofern die personenbezogene Feststellung der Versicherungspflicht und Feststellung der Beitragspflicht oder der Beitragshöhe wegen Verletzung der Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers nicht möglich ist. Kurz und knapp stellten die Kölner Richter fest, die Arbeitnehmer hätten aus dem strittigen Sachverhalt keinen geldwerten Vorteil zu versteuern. Um die grundsätzliche Frage zu klären, ob die Nachentrichtung von Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung aufgrund von Summenbescheiden lohnsteuerliche Folgen hat, wurde jedoch die Revision zugelassen. Wir sind gespannt, ob auch der BFH so arbeitnehmerfreundlich entscheidet. |
|
|
| |
Gewerbesteuerentlastung: Was bringt die neue GewSt-Anrechnung?Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften gibt es eine besondere Vergünstigung: Die Anrechnung der Gewerbesteuer (GewSt) auf den Teil der Einkommensteuer, der auf die gewerblichen Einkünfte entfällt. Die Details regelt
§ 35 EStG. Hiermit soll die Benachteiligung gegenüber Freiberuflern sowie Land- und Forstwirten, die nicht gewerbesteuerpflichtig sind, als auch gegenüber Kapitalgesellschaften, bei denen der Körperschaftsteuersatz lediglich 15 % beträgt, zumindest teilweise ausgeglichen werden. Bis 2019 betrug die Anrechnung das 3,8-fache des Gewerbesteuer- Messbetrags (max. die tatsächlich zu zahlende GewSt). Diese Anrechnung wurde durch das 'Zweite Corona-Steuerhilfegesetz' ab 2020 auf das 4,0-fache des Gewerbesteuer-Messbetrags heraufgesetzt. Wie sich die Anrechnung der Gewerbesteuer auswirkt, verdeutlicht das Beispiel im Kasten (dabei wird unterstellt, dass ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt werden). Nach altem Recht (bis einschließlich 2019) hätte die Anrechnung der Gewerbesteuer in unserem Beispiel bei 6.373 € (1.677 € × 3,8) gelegen. Berücksichtigt man den Solidaritätszuschlag, wurde bis 2019 eine vollständige Entlastung von Gewerbesteuer durch die Anrechnung bei kommunalen Hebesätzen bis 401 % erreicht. Ab 2020 liegt die Grenze bei einem Hebesatz von 422 %. Ist der Hebesatz Ihrer Kommune höher, bleibt es bei einer – zumindest teilweisen – Belastung mit Gewerbesteuer. Unterm Strich ergibt sich in unserem Beispiel ab 2020 eine Ersparnis bei der Einkommensteuer in Höhe von 335 €. Hinzu kommt eine geringe Entlastung beim Solidaritätszuschlag, wobei die reduzierte Bemessungsgrundlage (die zu zahlende Einkommensteuer) aber nicht für die Kirchensteuer gilt. Unser Fazit: Das ist zwar besser als nichts, hilft aber kleineren Betrieben letztlich auch nicht weiter. Die Anrechnung läuft sogar völlig ins Leere, falls die Einkünfte aus Gewerbebetrieb negativ sind, es durch Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) aber zu einem positiven Gewerbesteuermessbetrag kommt. Eine Verrechnung mit Einkünften zurückliegender oder künftiger Jahren scheidet ebenfalls aus. |
|
|
| |
Fallstricke bei Immobilien-Schenkungen an minderjährige Kinder„Mit warmen Händen soll man schenken“, sagt der Volksmund und meint, es sei besser, zu Lebzeiten Vermögen auf seine Kinder zu übertragen als mit kalten Händen zu vererben. Eltern und auch Großeltern können zivil- und steuerrechtlich
wirksam beträchtlichen Immobilienbesitz auch auf ihre noch minderjährigen Kinder bzw. Enkel steuerfrei übertragen. Die Freibeträge für die Beschenkten sind genauso hoch wie die Freibeträge für die Erben. Bei Kindern sind es 400.000 € bei jedem Elternteil und bei Enkeln jeweils 200.000 €. Diese Freibeträge erneuern sich alle zehn Jahre und können im Fall von Schenkungen mehrmals im Leben ausgenutzt werden. Nach der Rechtsprechung des BGH bedarf es bei der Schenkung einer Eigentumswohnung der Eltern an ihre minderjährigen Kinder zwar keiner vormundschaftlichen Genehmigung durch das örtlich zuständige Amtsgericht, wohl aber der Bestellung eines Ergänzungspflegers. Diesen Grundsatz kann man auch auf Schenkungen der Großeltern an die Enkel übertragen. Der BGH vertritt dabei die Auffassung, der Erwerb einer Eigentumswohnung sei für einen Minderjährigen stets nicht lediglich rechtlich vorteilhaft. Selbst für den Fall, dass sich der Schenker den Nießbrauch vorbehalte und dabei alle Kosten und Lasten übernehme, sei die Übertragung einer Eigentumswohnung für den Minderjährigen rechtlich nachteilig. Wer diese Hürde erfolgreich gemeistert und die Immobilie zivilrechtlich wirksam auf sein Kind übertragen hat, kann ertragsteuerlich dennoch in Schieflage geraten, wie eine fiskalfreundliche Entscheidung des FG Münster zeigt, über die der BFH als Revisionsinstanz demnächst noch sein endgültiges Urteil fällen muss. Im Streitfall hatten die Eltern ein Mehrfamilienhaus im Rahmen der vorweggenommen Erbfolge unter Einbeziehung eines Ergänzungspflegers auf ihren zu diesem Zeitpunkt noch minderjährigen Sohn übertragen. Anlässlich einer steuerlichen Betriebsprüfung wurde festgestellt, dass einzelne Mieten nach Übertragung des Objekts noch den Eltern zugeflossen waren. Zwar hatten die Ex-Vermieter ihre bisherigen Mieter schriftlich aufgefordert, mit Besitzübergang auf den Sohn am 1.8.2011 die Mieten auf das Konto des Sohnes bei der Y-Bank zu überweisen. Einige Mieter hatten aber ihre Daueraufträge nicht umgestellt und die August- und September- Mieten noch auf das alte Vermieterkonto einbezahlt. Diese „fehlgeleiteten“ Mieten wurden von den Eltern dann nicht „eins zu eins“ auf das Konto des Sohnes weiter überwiesen, wie es unter fremden Dritten zu erwarten gewesen wäre. Auch einige Aufwendungen für das übertragene Mietobjekt flossen weiter von dem Bankkonto der Eltern ab, z. B. Daueraufträge für die Hausverwaltung, Reinigungskosten, Abwassergebühren etc. Mangels „Fremdüblichkeit“ erkannten die Münsteraner Richter die Übertragungsvereinbarung hinsichtlich der Mieteinkünfte auf den minderjährigen Sohn nicht an. Wegen der Steuerprogression müssen die Eltern diese Einkünfte jetzt höher versteuern als der Sohn. Ob der BFH auch so strenge Maßstäbe anlegt, muss sich jetzt zeigen. Unser Rat: Vor der Übertragung von Immobilien an Kinder sollten Sie sich unbedingt steuerlich von uns beraten lassen. In gleichgelagerten Fällen werden wir negative Bescheide offenhalten, bis der BFH entschieden hat. |
|
| |
Corona-News: Kurz und knappAltersvorsorge
Auch Minijobber haben die Möglichkeit, eine Riester-Rente zu beanspruchen. Voraussetzung: Sie müssen rentenversicherungspflichtig sein, dürfen also nicht von der Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht Gebrauch machen. Rentenversicherungspflichtige Minijobber beteiligen sich aktuell mit einem Eigenanteil in Höhe von 3,6 % (bei Minijobbern in Privathaushalten 13,6 %) ihres Verdienstes an den Rentenversicherungsbeiträgen. Bei einem monatlichen Verdienst von 450 € entspricht das 16,20 €. Weitere nützliche Informationen zu dieser Thematik finden Sie hier: https://t1p.de/minijob-riester. Registrierkassen Aktuell gibt es noch keine cloudbasierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) für die elektronischen Aufzeichnungen von Kassensystemen. Dies bestätigte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Mehrere Kassenhersteller hätten mitgeteilt, das Zertifizierungsverfahren könne bis zum Stichtag 30.9.2020 nicht abgeschlossen werden. Corona Dass Corona-Soforthilfen nicht gepfändet werden können, hat bereits der BFH beschlossen. Jetzt entschied das FG Münster, diese können auch nicht gepfändet werden, falls ein Unternehmen sich zwar in der Insolvenz befindet, aber zukünftig Einnahmen generieren wird, die die Schließung des Unternehmens abwenden werden (hier handelt es sich um einen Immobilienverwalter, der auf die Fertigstellung eines Mietobjekts wartet und die Soforthilfe nutzte, um seine Betriebsausgaben zu decken). Kurzarbeitergeld Um die Belastungen der Coronakrise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzufedern, hat die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld erhöht und die Bezugsdauer verlängert. Auch die Voraussetzungen wurden für das Jahr 2020 vereinfacht. Was Sie im Einzelnen zum Kurzarbeitergeld wissen müssen, erfahren Sie in einem Fragen- und Antworten-Katalog, den die Bundesregierung aktuell veröffentlicht hat (www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles/kurzarbeitergeld-1774190). |
|
| |
|
| |
| |
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. |
|
|
|||||
|
|||||
|
| |
|
| |||
|