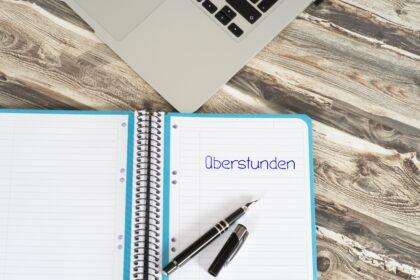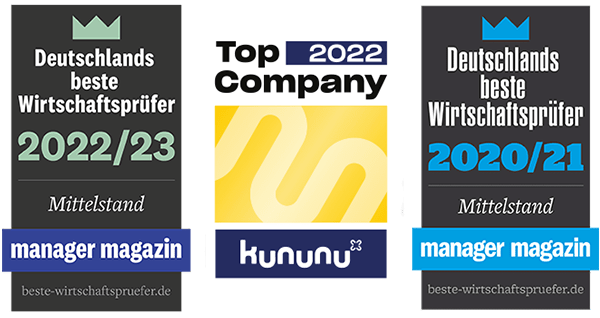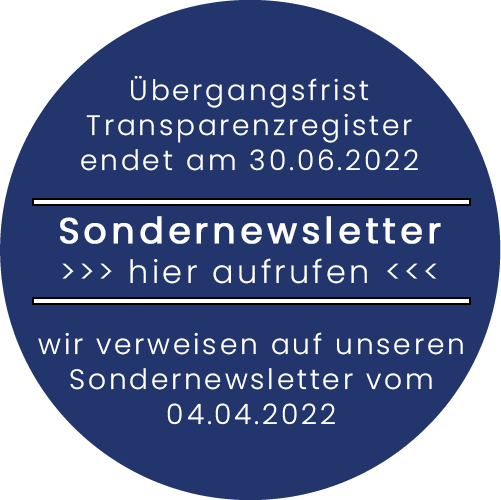|
Goldstein Consulting - Newsletter Juni 2022 ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
|
| |
Juni 2022
, Sie erhalten heute unseren Newsletter mit Neuigkeiten und wichtigen Änderungen in der Steuer- und Buchhaltungswelt. Wir hoffen, dass diese Informationen für Sie nützlich sein werden und stehen Ihnen unter den unten genannten Nummern und Links gern zur Verfügung. Alle vorangegangenen Infoblätter finden Sie hier unter Mandantenbriefe |
|
|
| |
Ein Ende der Corona-Pandemie ist weiter nicht in Sicht. Die Finanzverwaltung zeigt dafür die nötige Einsicht und verlängert – wie schon im Vorjahr – die Abgabefristen für die Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung. Im Vierten Corona-Steuerhilfegesetz ist vorgesehen, die
Abgabefristen für die Steuererklärung 2021 wie folgt zu verlängern:
Für nicht beratene Steuerzahler verschiebt sich die Abgabefrist um zwei Monate vom 31.7.2022 auf den 30.9.2022. Wird die Steuererklärung durch uns erstellt, verlängert sich die Abgabefrist um vier Monate auf den 30.6.2023. Ebenfalls verlängert werden die Abgabefristen für die Steuererklärungen 2022. Für Steuerzahler, die ihre Steuererklärung selbst erstellen, verschiebt sich die Abgabefrist um einen Monat vom 31.7.2023 auf den 31.8.2023. Wird die Steuererklärung durch einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein erstellt, ist die neue Abgabefrist zwei Monate länger und endet statt am 28.2.2024 spätestens am 30.4.2024.
Gleichzeitig soll für die Berechnung von Steuerzinsen die – regulär fünfzehnmonatige – zinsfreie Karenzzeit für den Besteuerungszeitraum 2020 ebenfalls um weitere drei Monate verlängert werden und für diesen Veranlagungszeitraum am 1.10.2022 enden. Dies betrifft gleichermaßen Erstattungs- wie Nachzahlungszinsen. Konsequenterweise wird entsprechend auch das restliche Fristensystem angepasst, so etwa bei den Verspätungszuschlägen oder den Vorabanforderungen von Steuererklärungen.
Hinweis: Wie schon im Mandanten-Brief Mai 2022 ausgeführt, plant die Bundesregierung, den Zinssatz für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2019 rückwirkend auf 0,15 % monatlich bzw. 1,8 % pro Jahr abzusenken. Das gilt sowohl für Steuernachzahlungen als auch -erstattungen.
|
|
|
| |
Wie lange darf eine Betriebsunterbrechung dauern?
Bei einer Betriebsaufgabe oder Betriebsveräußerung endet die unternehmerische Tätigkeit. Die Konsequenz ist die Versteuerung des Veräußerungs- oder Aufgabegewinns, die durch eine Freibetragsregelung und den ermäßigten Steuersatz abgemildert wird. Als weitere Option steht das Instrument der Betriebsunterbrechung (ruhender Gewerbebetrieb) zur Verfügung. Der Unterschied zur Betriebsaufgabe bzw. -veräußerung: Die bislang ausgeübte Tätigkeit ruht komplett, das Unternehmen existiert aber weiterhin. Die Aufdeckung der stillen Reserven bzw. deren Versteuerung entfällt zunächst. Voraussetzung ist jedoch, dass der Betriebsinhaber seine Tätigkeit innerhalb eines angemessenen Zeitraums wieder aufnehmen könnte. Von daher wäre es schädlich, alle betriebsnotwendigen Maschinen oder Einrichtungsgegenstände zu verkaufen bzw. ins Privatvermögen zu überführen. Zwar gibt es keine feste zeitliche Grenze für eine Betriebsunterbrechung. Allerdings müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Finanzamt im Laufe der Jahre nachhakt und eine Betriebsaufgabe unterstellen will. Die Finanzverwaltung hat die Einzelheiten hierzu in einem Schreiben vom 22.11.2016 geregelt: Dort heißt es:
„Liegen die Voraussetzungen einer Betriebsunterbrechung oder einer Betriebsverpachtung im Ganzen vor, gilt der Betrieb unwiderleglich so lange nicht als aufgegeben, bis der Steuerpflichtige die Betriebsaufgabe erklärt oder dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, dass zwischenzeitlich eine Betriebsaufgabe stattgefunden hat.“
In einem aktuell veröffentlichten Urteil musste der BFH zur Dauer einer Betriebsunterbrechung Stellung nehmen. Die Richter stellen klar, es stehe der Annahme einer Betriebsunterbrechung nicht entgegen, dass ein außergewöhnlich
langer Zeitraum vorliegt (im Streitfall ging es um eine Zeitspanne von immerhin 61 Jahren) und der bisherige Betriebsinhaber verstorben sei und die wesentlichen Betriebsgrundlagen von einer Erbengemeinschaft gehalten würden. Allerdings müssen Sie bedenken, dass im Laufe der Jahre, vor allem bei Immobilien, die Verkehrswerte steigen und der spätere Gewinn umso höher ausfällt.
Unser Rat: Möglich wäre auch eine Betriebsverpachtung. Dann käme das sog. 'Verpächterwahlrecht' zur Anwendung: Sie können die Betriebsaufgabe erklären (mit Aufdeckung der stillen Reserven) und anschließend durch Verpachtung der wesentlichen Betriebsgrundlagen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielen oder die gewerbliche Tätigkeit durch die Betriebsverpachtung fortführen und weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen, die aber nicht mehr der Gewerbesteuer unterliegen. Welche der drei Optionen die richtige ist, sollte im Einzelfall entschieden werden.
|
|
|
| |
Bewirtungskosten: Streit um handschriftliche Rechnungen
Sofern Sie Geschäftsfreunde, Kunden oder andere Personen aus geschäftlichem Anlass bewirten, müssen Sie nicht nur die ertragsteuerliche Kürzung in Höhe von 30 % akzeptieren (den Vorsteuerabzug haben Sie zu 100 %). Obendrein hat der Gesetzgeber noch formelle Hürden aufgestellt, die der Bewirtende beachten muss: Danach müssen Sie zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen schriftlich folgende Angaben machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Nur bei Kleinbetragsrechnungen bis 250 € brutto muss der Unternehmer nicht als Rechnungsadressat aufgeführt sein. Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teilnehmern der Bewirtung. Daneben ist die Rechnung beizufügen. Zusätzlich hat die Finanzverwaltung die Anforderungen seit Juni 2021 noch weiter verschärft. Danach muss die Rechnung des Bewirtungsbetriebs „maschinell erstellt und elektronisch aufgezeichnet sein.“ Im Gesetz steht davon nichts. Ergo müsste auch eine handgeschriebene Rechnung als Nachweis genügen. Genau mit dieser Frage musste sich jüngst das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg beschäftigen. Völlig
zutreffend weist es darauf hin, der Anforderung einer maschinellen Rechnung der Gaststätte für die Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen fehle jede Rechtsgrundlage. Ebenso habe der BFH in seinen Grundsatzurteilen zu den Formerfordernissen eine solche Notwendigkeit nie erwähnt. Endgültig entschieden ist der Streit aber noch nicht, da beim BFH eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil anhängig ist.
Unser Rat: Geschäftliche Bewirtungskosten müssen 'einzeln' und 'getrennt' von den sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden. Einzeln aufzeichnen bedeutet, mehrere Positionen (Rechnungen) dürfen nicht zusammengefasst werden. Eine Sammelrechnung braucht nicht aufgeteilt zu werden. Sie kann in einer Summe gebucht werden. Bei Kreditkartenabrechnungen ist ebenfalls eine Sammelbuchung möglich, soweit sich die Einzelheiten aus den dazugehörigen Belegen ergeben. Getrennt von den übrigen Aufwendungen aufzeichnen bedeutet, innerhalb der Buchführung muss ein eigenes Konto bzw. im Journal eine eigene Spalte verwendet werden. Einzelne Fehlbuchungen, wie sie in der Praxis nicht auszuschließen sind, sind unschädlich.
|
|
|
| |
Steuerermäßigung für zusammengeballte Überstundenvergütung
Für sog. 'außerordentliche Einkünfte' sieht das Einkommensteuergesetz eine ermäßigte Besteuerung vor. Solche Einkünfte liegen z. B. vor, sofern sie einmalig in einem einzigen Veranlagungszeitraum zufließen, aber aus mehreren Jahren resultieren, wobei eine Aufteilung in mehrere Teilzahlungen grds. möglich ist. Außerordentliche Einkünfte steigern das Jahreseinkommen überproportional und ziehen eine hohe Steuerprogression nach sich. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen können sie nach der sog. 'Fünftelregelung' ermäßigt besteuert werden, damit die Steuerprogression abgemildert wird. Hierzu gehören - Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen und
- Zahlungen für die Aufgabe einer Tätigkeit. Daneben sind auch
- Vergütungen für 'mehrjährige Tätigkeiten' in diesem Sinne begünstigt.
Bereits im Jahr 2019 befasste sich das FG Münster mit der Frage, ob Zahlungen für angesammelte Überstunden in diesem Sinne steuerlich begünstigt sein können. Der Fall: Ein Arbeitnehmer arbeitet für ein Bauunternehmen. Bei guter Auftragslage leistet er in drei Jahren je 300 Überstunden, die er sich auf einem Überstundenkonto gutschreiben lässt. Dann wird er jedoch krank. Drei Jahre bleibt er krankgeschrieben und der Arbeit fern. Das Überstundenkonto bleibt unangetastet. Der Mitarbeiter erhält die krankheitsbedingten Lohnfortzahlungen. Als absehbar ist, dass er seine Tätigkeit nie wieder ausführen kann, schließt er mit dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag, um eine krankheitsbedingte Kündigung zu umgehen. In diesem Vertrag wird festgesetzt, dass ihm für die angesammelten Überstunden 5.000 € gezahlt werden. Der Arbeitnehmer beansprucht für die Entlohnung der Überstunden den ermäßigten Steuersatz für außerordentliche Einkünfte (Fünftelregelung). Das FG entschied zugunsten des Arbeitnehmers. Die Nachzahlung einer Überstundenvergütung könne nicht anders beurteilt werden als die Nachzahlung von Lohn für reguläre Arbeitsleistung. Abschließend entschieden war die Sache nicht. Drei Jahre später hat nun der BFH das letzte Wort gesprochen und das Urteil rechtskräftig bestätigt.
Daraus folgt für die Praxis: Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten liegen vor, wenn die in einer Summe entlohnte Tätigkeit sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten erstreckt. Dabei reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn in einem anderen Veranlagungszeitraum zufließt als dem, zu dem er wirtschaftlich gehört. Die Entlohnung muss für sich betrachtet zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit sein. Die Zweckbestimmung kann sich entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus den übrigen Umständen ergeben. Darüber hinaus muss die Entlohnung aus wirtschaftlich vernünftigen Gründen in zusammengeballter Form erfolgen.
|
|
|
| |
Wann liegt eine erste Tätigkeitsstätte vor?
Arbeitnehmer mit ständig wechselnden Einsatzstellen (sog. Einsatzwechseltätigkeit) können sämtliche Fahrten mit dem eigenen Pkw nach Dienstreisegrundsätzen abrechnen (0,30 € je tatsächlich gefahrenem Kilometer bzw. individueller Kilometersatz sowie Verpflegungsmehraufwendungen bei mehr als achtstündiger Abwesenheit von zu Hause). Voraussetzung: Keiner der Einsatzorte gilt als erste Tätigkeitsstätte. Andernfalls gibt es für die Fahrten von der Wohnung dorthin nur die Entfernungspauschale. Zudem ist die Anerkennung von Verpflegungsmehraufwendungen begrenzt.
In Arbeitsverträgen werden mitunter Formulierungen gewählt, die nach Ansicht der Finanzverwaltung als Festlegung einer ersten Tätigkeitsstätte zu verstehen sind. Beispielhaft hierfür sind Verträge mit leitenden Mitarbeitern international tätiger Unternehmen, bei denen ein bestimmter Standort mit einem Niederlassungsgebäude als 'Einstellungsort' bezeichnet wird. Eine solche Formulierung bedeutet aber nicht automatisch das 'Aus' für eine Einsatzwechseltätigkeit, wie das FG Mecklenburg-Vorpommern in einem Urteil feststellt.
Mit der Festlegung eines 'Einstellungsorts' werde der Mitarbeiter nicht automatisch einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung zugeordnet. Damit wolle der Arbeitgeber lediglich die Zuordnung zu einem Bezirk, nicht aber zu einem bestimmten Gebäude regeln. Die Vertragsklausel hätte auch dann ihren Sinn behalten, wenn die Niederlassung (das Gebäude) an einen anderen Ort innerhalb des bisherigen Bezirks des Mitarbeiters verlegt worden wäre oder der Arbeitgeber vollständig auf das Niederlassungsgebäude verzichten würde und seine Arbeitnehmer in Heimarbeit bzw. anderweitig tätig wären. Auch gelegentliche Besprechungen des Mitarbeiters in der Niederlassung und ein gelegentliches Abholen der in Papierform eingehenden Post schlössen eine Einsatzwechseltätigkeit nicht aus.
Wichtig: Die Richter ließen die Revision wegen der möglichen Auswirkungen auf eine Vielzahl vergleichbarer Fälle zu. Die Revision ist beim BFH anhängig. In vergleichbaren Fällen werden wir unter Hinweis auf diesen Musterprozess Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen.
|
|
|
| |
Bruchteilsgemeinschaft nicht automatisch Ehegatten-GbR
Erwerben Eheleute vom Bauträger noch zu errichtende Wohnungen und erklären in den notariellen Verträgen, diese zu hälftigen Miteigentumsanteilen zu erwerben und nach Fertigstellung gemeinsam und langfristig zu vermieten, treten sie nach Auffassung der Finanzverwaltung als Unternehmer in der Rechtsform einer Ehegatten-Vermietungs- GbR auf. In diesem Fall müssten sie die bereits an das Bauunternehmen gezahlte Umsatzsteuer nach § 13b UStG (Umkehrung der Steuerschuldnerschaft) nochmals entrichten und entsprechende Steuererklärungen abgeben. Glücklicherweise hat der BFH dieser fiskalfreundlichen Auffassung im Revisionsverfahren widersprochen.
Im Streitfall erwarb ein Ehepaar zwei noch zu errichtende Wohnungen in einem Seniorenwohnheim zu hälftigem Miteigentum. Der Verkäufer optierte zur Umsatzsteuer und wies darauf hin, dass die Eheleute Steuerschuldner seien. Diese weigerten sich, eine USt-Erklärung einzureichen, da sie weder Unternehmer noch eine juristische Person seien. Das Finanzamt argumentierte, eine unternehmerisch tätige Ehegatten-Vermietungs-GbR 'überlagere' die zivilrechtliche Bruchteilsgemeinschaft. Es erließ einen USt- Bescheid im Schätzungswege, adressiert an die 'Ehegatten- GbR', den der BFH jedoch für rechtswidrig erklärte.
Unser Fazit: Durch die beabsichtigte Vermietung eines im gemeinsamen Eigentum der Ehegatten stehenden Grundstücks entsteht nicht automatisch eine BGB-Gesellschaft zwischen den Eheleuten. Ist vertraglich nichts anderes vereinbart, handelt es sich auch bei der anschließenden Vermietung von Miteigentum durch eine Bruchteilsgemeinschaft lediglich um eine Verwaltungsmaßnahme, die eine Bruchteilsgemeinschaft nicht automatisch in eine Gesellschaft umwandelt. Die Absicht, durch die Vermietung Gewinn zu erzielen, kann auch im Rahmen der Bruchteilsgemeinschaft verwirklicht werden. Die BGB-Gesellschaftsform ist hierfür nicht erforderlich, auch wenn es gute Gründe für den Erwerb als GbR gibt (z. B. keine Veräußerung ohne Zustimmung des anderen Gesellschafters).
|
|
|
| |
Kurz und knapp auf den Punkt gebracht
CO2-StufenmodellSeit 2021 wird in Deutschland ein Preis für die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) erhoben. Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz sollen nach dem Willen der Bundesregierung Vermieter künftig 90 % und die Mieter
10 % der CO2-Kosten übernehmen. Entspricht das Gebäude mindestens dem Standard EH 55, müssen die Vermieter keine CO2-Kosten mehr tragen. Ausnahmen soll es geben, falls Vermieter, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Milieuschutzgebieten, keinen Beitrag zur energetischen Sanierung leisten können. Das Stufenmodell gilt für alle Wohngebäude einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie Gebäude mit gemischter Nutzung, in denen Brennstoffe genutzt werden, die unter das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fallen.
Handwerkerleistungen
Für statische Berechnungen eines Statikers kann keine Steuerermäßigung nach
§ 35a EStG beansprucht werden, selbst dann nicht, wenn sie für die Durchführung einer Handwerkerleistung erforderlich waren. Dies entschied aktuell der BFH. Begründung: Es handele sich ausschließlich um Leistungen im Bereich der Planung und rechnerischen Überprüfung von Bauwerken. Unerheblich sei die Erforderlichkeit der statischen Berechnung für die Durchführung der begünstigten Handwerkerleistungen. In der Vorinstanz hatte das FG Baden-Württemberg zugunsten des Eigentümers entschieden.
Abgeltungsteuer
Das Niedersächsische Finanzgericht ist der Auffassung, die sogenannte Abgeltungsteuer auf Kapitaleinkünfte sei verfassungswidrig. Die Abgeltungsteuer (zum Beispiel auf Zinsen oder Dividenden) wird direkt von den Banken einbehalten und an das Finanzamt abgeführt – pauschal in Höhe von 25 %. In dem konkreten Fall hatte ein Versicherungsmakler Korrekturen bezüglich der Abgeltungsteuer verlangt, die das Gericht im Grunde für gerechtfertigt hält. Dennoch gewährte es ihm keine Steuererstattung. Denn auf der anderen Seite sei die Besteuerung der Kapitaleinkünfte des Maklers 'verfassungswidrig zu niedrig', weil bei der Einkommensteuer der Steuersatz bis zu 45 % betragen kann. Das letzte Wort hat nun das Bundesverfassungsgericht.
|
|
|
| |
Steuertermine Juni 2022
Bitte reichen Sie für die folgenden Steuerarten frühzeitig Ihre Unterlagen bei uns ein! - Umsatzsteuer
- Lohnsteuer
- Solidaritätszuschlag
- Kirchenlohnsteuer ev./rk.
Ende der Zahlungsfrist: Scheck*/bar: Freitag, 10. Juni Banküberweisung: Montag, 13. Juni * Scheck muss spätestens 3 Tage vor Fälligkeit dem Finanzamt vorliegen! |
|
|
| |
 Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Die Texte werden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt.
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. |
|
|
| |
Goldstein Consulting GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fasanenstraße 77
10623 Berlin
Telefon: +49 30 3030 8999
Fax: +49 30 3030 8919
E-Mail: office@goldsteinconsulting.de
Geschäftsführung: WP/StB Annette Goldstein
© Goldstein Consulting GmbH
|
|
|
|
|
|
|
| |
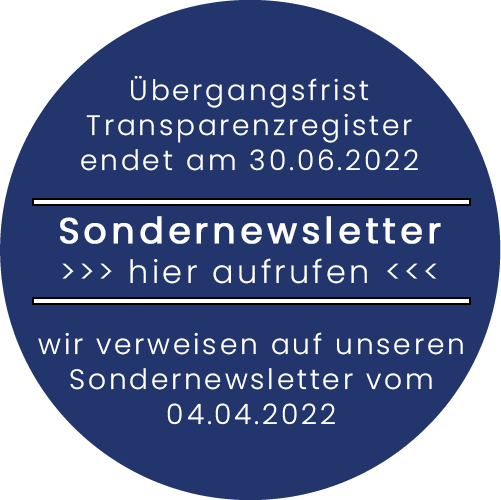
|
|
|
|
|