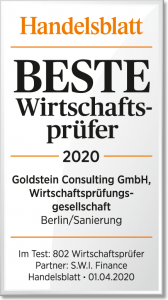| |
|
| |||
|
| |
Dezember 2020 , |
|
|
| |
Nur noch wenige Wochen bleiben, dann ist die zum 1.7.2020 eingeführte Umsatzsteuersenkung auf 16 % bzw. 5 % schon wieder Geschichte. Am 1.1.2021 steigen die USt- Sätze wieder auf ihre altbekannten Höhen von 19 % und 7 %. Ob sich der Aufwand der zweimaligen Umstellung letztlich ausgezahlt hat, wird sich noch zeigen müssen. Zumindest hat Ihnen der Gesetzgeber – anders als bei der hastig beschlossenen und umgesetzten Umsatzsteuersatzsenkung – ausreichend Zeit gegeben, sich auf die Änderung vorzubereiten.
Dazu zählt auch die rechtzeitige Vereinbarung von Terminen mit den für die Kassen- und Rechnungsumstellung zuständigen Serviceunternehmen. Auch werbliche Aktivitäten mit 'Last-Minute'- Angeboten sind noch möglich. Umsatzsteuertechnisch gibt es sogar ein wenig Gestaltungspotenzial. Beispielsweise könnten nach dem 31.12.20 endende Dauerleistungen (z. B. Wartungs- und Inspektionsarbeiten) unter Umständen in Teilleistungen aufgesplittet werden, so dass Teile der Leistung noch mit 16 % bzw. 5 % berechnet werden. Teilleistungen liegen vor, soweit folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
offen sind oder sich in Bearbeitung befinden auf und legen Sie zusammen mit uns fest, wie die Rechnungsstellung aussehen muss. Hintergrund: Die neuen Umsatzsteuersätze 2021 werden nur fällig, wenn eine Lieferung oder Leistung ab dem 1.1.2021 ausgeführt (beendet) wird. Beispiel: Sie haben im Dezember 2020 einen Auftrag von einem Kunden über netto 5.000 € erhalten, der voraussichtlich im Januar 2021 abgeschlossen wird. Folge: Da die Leistung im Januar 2021 als ausgeführt gilt, müssen Sie in der Rechnung 19 % USt ausweisen. Abwandlung: Sie haben im November 2020 einen Auftrag von einem Kunden über netto 5.000 € erhalten, der im Dezember 2020 abgeschlossen wird. Die Rechnungsstellung erfolgt aber frühestens im Januar 2021. Folge: Da die Leistung im Dezember 2020 als ausgeführt gilt, müssen Sie in der Rechnung 16 % USt ausweisen. Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung spielt bei der Frage nach dem korrekten Umsatzsteuersatz keine Rolle. |
|
|
| |
Praxisverkauf: Fiskus macht Kehrtwende um 180 GradFreiberufler, z. B. Ärzte, Heilpraktiker, Rechtsanwälte, Notare, Ingenieure und Architekten, die ihre Praxis bzw. Kanzlei verkaufen, profitieren ebenso wie Gewerbetreibende von Steuervergünstigungen, insbesondere wenn der Praxis oder Kanzlei-Inhaber das 55. Lebensjahr vollendet hat oder im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Vom Veräußerungsgewinn sind dann bis zu 45.000 € steuerfrei.
Der Freibetrag wird bei Veräußerungsgewinnen von mehr als 136.000 € allmählich abgeschmolzen. Ab einem Veräußerungsgewinn von 181.000 € wird somit kein Freibetrag mehr gewährt. Der verbleibende Veräußerungsgewinn wird dann nur mit 56 % des durchschnittlichen persönlichen Steuersatzes, mindestens mit 14 % besteuert. Bei einem persönlichen Duchschnittssteuersatz von 40 % würde der steuerpflichtige Gewinn aus der Praxisveräußerung somit nur mit 22,4 % besteuert. Freibetrag und besonderer Steuersatz sind antragspflichtig und werden nur einmal im Leben gewährt. Die Anträge können nur bis zur Bestandskraft des Steuerbescheids zurückgenommen werden. Wirkt sich der Freibetrag auch nur teilweise aus, gilt er bereits als verbraucht. Eine wichtige Voraussetzung für eine steuerbegünstigte Veräußerung ist jedoch, dass der bisherige Praxis- bzw. Kanzlei-Inhaber die freiberufliche Tätigkeit einstellt und zwar
entfielen in den letzten drei Jahren vor dem Verkauf durchschnittlich weniger als 10 % der gesamten Einnahmen. Bis vor Kurzem stellte die Finanzverwaltung noch eine weitere Hürde auf, wonach die Hinzugewinnung neuer Mandanten/ Patienten innerhalb der 'gewissen' Zeit nach Betriebsaufgabe auch ohne Überschreiten der 10 %-Grenze generell schädlich sein sollte. Hier hat der BFH dem Fiskus jedoch seine Grenzen aufgezeigt und dazu in einer Entscheidung klargestellt: Auch die Betreuung neuer Mandate schließt das Vorliegen einer begünstigten Praxisveräußerung nicht automatisch aus, falls die 10 %-Grenze nicht überschritten wird. Dieser Entscheidung haben sich alle Länder gebeugt. Bundeseinheitlich gilt nun folgende Veranlagungspraxis: Wird nach Veräußerung oder Aufgabe einer freiberuflichen Praxis die bisherige Tätigkeit im gleichen örtlichen Wirkungskreis nur in geringem Umfang fortgeführt, ist dies für die Annahme einer begünstigten Veräußerung oder Aufgabe auch dann unschädlich, wenn dabei auch neue Mandate/ Patienten hinzugewonnen bzw. betreut werden. Damit ist nun endlich Rechtssicherheit für die Praxis erreicht. |
|
|
| |
Gesundheitsvorsoge: So bleiben bis zu 600 € steuerfreiIn Corona-Zeiten immer wichtiger: Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber Geld- oder Sachleistungen zur Gesundheitsvorsorge erhalten, unterstützt der Gesetzgeber mit einem Freibetrag von 600 € p. a. (bis zu dieser Höhe gilt dann auch Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung). Die Förderung gibt es bereits seit 2008, wobei die Regelungen auch hier sehr komplex sind. Die Finanzverwaltung will deshalb laut einem internen Papier der OFD Karlsruhe verschärft in Prüfungen einsteigen. Wichtigste Voraussetzung ist, die Leistungen müssen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Konkret fallen unter die Steuerbefreiung:
1. Maßnahmen zur verhaltensbezogenen Prävention, die nach SGB V zertifiziert sind. Hierzu muss man wissen: Die meisten Krankenkassen lassen ihre Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention im Rahmen einer Kooperationsgemeinschaft über die 'Zentrale Prüfstelle Prävention' des Dienstleistungsunternehmens 'Team Gesundheit GmbH' prüfen und zertifizieren. Die zertifizierten Präventionskurse finden meist außerhalb des Betriebsgeländes statt und werden vom Arbeitgeber bezuschusst. Die Teilnahme ist vom Arbeitnehmer mit einer vom Kursleiter unterschriebenen Teilnahmebescheinigung nachzuweisen. Sofern der Arbeitnehmer selbst in finanzielle Vorleistung tritt, kann er bei seinem Arbeitgeber unter Vorlage der Teilnahmebescheinigung eine Arbeitgeberförderung beantragen. Für das Zertifikat, die Teilnahmebescheinigung und den Antrag auf Arbeitgeberförderung enthält die Verfügung entsprechende Muster. 2. Gesundheitsförderliche Maßnahmen in Betrieben (betriebliche Gesundheitsförderung), die den vom 'Spitzenverband Bund der Krankenkassen' nach SGB V festgelegten Kriterien entsprechen. Wichtig: Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförderung des Arbeitgebers sind steuerbegünstigt, sofern die Leistungen Bestandteil eines betrieblichen Gesundheitsförderungsprozesses sind und im Handlungsfeld 'Gesundheitsförderlicher Arbeits- und Lebensstil' erbracht werden. Hierzu gehören die Bereiche
außerhalb in einer geeigneten Einrichtung (z. B. Fitness-Studio, Sportverein, Praxisräume freiberuflicher Fachkräfte) erbracht werden. Beachten Sie: Die Leistungen des Arbeitgebers sind grundsätzlich mit den um übliche Preisnachlässe geminderten Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Zuzahlungen des Arbeitnehmers sind dabei anzurechnen. Laut OFD Karlsruhe bestehen aber keine Bedenken, wenn die Leistungen aus Vereinfachungsgründen mit den tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitgebers bewertet werden. Die Aufwendungen sind zu gleichen Teilen auf alle am Präventionskurs teilnehmenden oder beim Vortrag anwesenden Arbeitnehmer aufzuteilen. Unser Rat: Unabhängig hiervon sind Leistungen des Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung steuerfrei, sofern sie im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse erfolgen und daher nicht als Arbeitslohn anzusehen sind. In diesem Fall dürfen die Aufwendungen auch mehr als 600 € p. a. betragen. Beispiele:
|
|
|
| |
Steuerbonus für Elektrofahrzeuge bis 31.12.2030 verlängertDie Vorschriften zur steuerlichen Förderung der Elektromobilität sind mittlerweile sehr umfangreich und werden ständig modifiziert. Bereits seit 2017 sind vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische Aufladen eines Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers und für die zeitweise zur privaten Nutzung überlassene betriebliche Ladevorrichtung steuerbefreit. Diese steuerfreien Bezüge sind nicht im Lohnkonto aufzuzeichnen. Zudem können Firmen-Chefs die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der Übereignung (Schenkung) einer Ladevorrichtung sowie Zuschüsse zu den Aufwendungen der Mitarbeiter für den Erwerb sowie die Nutzung einer Ladevorrichtung pauschal mit 25 % versteuern.
Beide Vorschriften sollten ursprünglich zum Jahresende auslaufen, sind aber bis zum 31.12.2030 verlängert worden. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Wichtig! Eine Gehaltsumwandlung, z. B. zugunsten einer privaten Wallbox, ist damit nicht möglich. Der betriebliche Ladestrom bleibt auch sozialversicherungsfrei. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Privat- oder Firmenfahrzeug handelt. Während bei der 1 %-Regelung der vom Arbeitgeber gestellte Ladestrom ohnehin durch den Ansatz des pauschalen Nutzungswerts abgegolten ist, werden Firmenwagen bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode durch die Herausnahme der Stromkosten in die Begünstigung einbezogen. Für die Steuerbefreiung gilt weder ein Höchstbetrag noch ist die Anzahl der begünstigten Kraftfahrzeuge begrenzt. Begünstigt ist das Aufladen an jeder ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines mit dem Arbeitgeber verbundenen Unternehmens. Die Steuerbefreiung gilt auch für Leiharbeitnehmer im Betrieb des Entleihers. Falls Arbeitnehmer betriebliche Elektrofahrzeuge bei sich zu Hause privat aufladen, stellen Erstattungen des Arbeitgebers steuerfreien Auslagenersatz dar. Hier ermöglichte es die Finanzverwaltung bisher schon, unterschiedlich hohe monatliche Pauschalen typisierend zugrunde zu legen. Diese Pauschalen werden ab 2021 auf bis zu 70 € monatlich angehoben, abhängig davon ob es eine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gibt. Dieses Steuerbonbon war bis zum 31.12.2020 befristet. Ein aktuelles BMF-Schreiben sieht nun eine Verlängerung sowie eine Anhebung der Pauschalen ab dem 1.1.2021 bis zum 31.12.2030 vor. Zudem enthält es weitere wichtige Hinweise zur Pauschalierung der Lohnsteuer und zu den erforderlichen Aufzeichnungen im Lohnkonto. Unser Tipp: Steuer- und sozialversicherungsfrei können auch Elektrofahrräder aufgeladen werden, die mit Motorunterstützung schneller als 25 km/h sind sowie Elektrokleinstfahrzeuge (z. B. Elektroroller). Aus Billigkeitsgründen wendet die Finanzverwaltung die Steuerfreiheit für das elektrische Aufladen auch auf Elektrofahrräder an, die nicht als Kfz einzustufen sind (u. a. keine Kennzeichen und Versicherungspflicht). |
|
|
| |
Darlehensvorbehalt mindert Steuerbelastung beim NießbrauchImmobilienwert als Grundlage. Der Gegenwert des Nießbrauchs wird abgezogen. Das mindert also direkt den steuerlichen Wert. Um den Gegenwert des Nießbrauchs zu berechnen, werden das Alter des Schenkers bzw. seine wahrscheinliche Lebenserwartung herangezogen. Der Berechnung liegen die Sterbetafeln des Statistischen Bundesamts zugrunde.
Wie erheblich dieser Vorteil ausfallen kann, zeigt folgendes Beispiel: Die Eltern zweier Kinder haben einen gemeinsamen Immobilienbesitz von 6.000.000 € und möchten diesen auf ihre beiden Kinder übertragen. Hierfür legen wir einen realistischen Kapitalwert des Vorbehaltsnießbrauchs von 60 % des Immobilienwerts zugrunde. Damit beträgt der für die Schenkungsteuer maßgebende Wert der Bereicherung pro Kind 1.200.000 €. Folglich hat jedes Kind pro Elternteil eine Schenkung in Höhe von 600.000 € zu versteuern. Davon ist der persönliche Freibetrag von 400.000 € je Kind und Elternteil abzuziehen, sodass letzten Endes nur noch 200.000 € mit einem Steuersatz von 11 % zu versteuern sind. Daher fällt eine Schenkungsteuer von lediglich 22.000 € pro Kind und Elternteil an. Worauf es bei dieser Gestaltung ankommt, zeigt ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Münster. Im Streitfall hatte der Sohn von seiner Mutter zwölf vermietete Eigentumswohnungen geschenkt bekommen, wobei die Mutter sich ein lebenslängliches und unentgeltliches Nießbrauchsrecht (sprich Zufluss der Mieten) vorbehalten hatte. Die Grundschulden übernahm der Sohn nur mit dinglicher Wirkung. Persönliche Schuldnerin der Darlehen blieb seine Mutter, die sämtliche Zins- und Tilgungszahlungen für die Verbindlichkeiten weiter leistete. In seiner Schenkungsteuererklärung zog der Sohn den kapitalisierten Jahreswert des Nießbrauchs der Mutter erwerbsmindernd ab. Das Finanzamt war der Auffassung, die von der Mutter zu leistenden Zins- und Tilgungszahlungen seien als steuerpflichtige Bereicherung zu berücksichtigen. Deshalb sei der Nießbrauch nur mit einem entsprechend niedrigeren Wert abzugsfähig. Der hiergegen erhobenen Klage hat das Gericht stattgegeben. Begründung: Anders als in einem bereits vom BFH fiskalfreundlich entschiedenen Urteil aus dem Jahr 2017 sei der persönliche Schuldübergang auf den Sohn hier nur aufschiebend bedingt – bis zum Erlöschen des Nießbrauchsrechts beim Tod der Mutter – vereinbart worden. Damit sei der Sohn im Zeitpunkt der Schenkung weder rechtlich noch tatsächlich durch die Verbindlichkeiten und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen des Grundbesitzes persönlich belastet. Infolgedessen könne er weder durch die Zins- noch durch die Tilgungsleistungen seitens der Mutter bereichert sein. Der Wert des Nießbrauchsrechts sei daher nicht zu mindern. Eine Bereicherung des Beschenkten erfolge erst bei Bedingungseintritt. Unser Rat: Das Urteil hat leider nur vorläufigen Charakter. Ob der BFH als Revisionsinstanz die Entscheidung bestätigt, wird sich zeigen müssen. Gegen negative Bescheide werden wir vorsorglich Einspruch einlegen und Ruhen des Verfahrens beantragen, bis das Urteil veröffentlicht ist. |
|
| |
Kurz und knapp auf den Punkt gebrachtLohnsteueraußenprüfung
Unternehmen, die ihre Löhne selbst abrechnen, versäumen es häufig, im Anschluss an eine Lohnsteueraußenprüfung aus deren Feststellungen auch die sozialversicherungsrechtlichen Folgen zu ziehen. Nach den einschlägigen Vorschriften des SGB IV i. V. m. der Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt richtet sich die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Arbeitsentgelt grds. nach dem Steuerrecht. Stellt das Finanzamt im Rahmen einer Prüfung fest, dass Arbeitslohn bisher nicht versteuert wurde, fallen in aller Regel auch Sozialversicherungsbeiträge an. Diese sind grundsätzlich bis zum drittletzten Bankarbeitstag des Monats, der der Bestandskraft der Entscheidung der Finanzverwaltung folgt, an die zuständige Einzugsstelle zu entrichten. Sollte dies unterbleiben, kommt es bei der nächsten Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung nicht nur zu einer Nachzahlung, es fallen in aller Regel auch Säumniszuschläge an. Corona Nachdem die steuerfreie Bonuszahlung von bis zu 1.500 € an Arbeitnehmer im Einkommensteuergesetz verankert wurde, sah sich das BMF veranlasst, hierzu Stelllung zu nehmen. Wichtig ist der Hinweis, dass andere Steuerbefreiungen, Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten hiervon unberührt bleiben und neben der neuen Steuerbefreiungsvorschrift in Anspruch genommen werden können. Beachten Sie: Über eine im Raum stehende Verlängerung des Begünstigungszeitraums bis zum 31.1.2021 hat der Gesetzgeber noch nicht abschließend entschieden. |
|
| |
Steuertermine Dezember 2020Bitte reichen Sie für die folgenden Steuerarten frühzeitig Ihre Unterlagen bei uns ein!
Scheck*/bar: Donnerstag, 10. Dezember Banküberweisung: Montag, 14. Dezember * Scheck muss spätestens 3 Tage vor Fälligkeit dem Finanzamt vorliegen! |
|
| |
|
| |
| |
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. |
|
|
|||||
|
|||||
|
| |
|
| |||
|