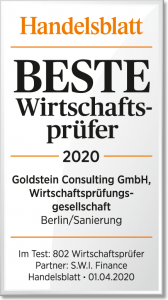| |
|
| |||
|
| |
April 2021 , |
|
|
| |
Corona zwingt viele Berufstätige weiterhin dazu, ihren Job an ihrem heimischen Arbeitsplatz auszuüben. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und bietet rückwirkend ab 1.1.2020 allen, die kein häusliches Arbeitszimmer steuerlich absetzen können (oder auf die Geltendmachung verzichten) eine neue Steuervergünstigung an.
Selbständige und Arbeitnehmer können danach für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich zu Hause arbeiten, eine Homeoffice-Pauschale von 5 € ansetzen, höchstens 600 € im Jahr (maximal werden also 120 Tage berücksichtigt). Im Gegenzug entfällt an diesen Tagen die Geltendmachung der Entfernungspauschale für Fahrten zum Betrieb/ Arbeitsstätte. Obwohl die neue Regelung eigentlich nicht kompliziert ist, sind dennoch einige Punkte zu beachten. Klar ist: Eine höhere Steuerersparnis als mit der Homeoffice- Pauschale lässt sich fast immer mit einem 'klassischen' oder 'echten' häuslichen Arbeitszimmer erzielen. Voraussetzung dafür ist, es muss sich um einen abgeschlossenen (büromäßig eingerichteten) Raum in der Wohnung handeln, der ausschließlich (oder zumindest fast ausschließlich, also zu mindestens 90 %) für betriebliche bzw. berufliche Zwecke genutzt wird. Eine sog. Arbeitsecke reicht hier nicht. Ein Abzug der Raumkosten ist in voller Höhe möglich, falls das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. Das gilt auch dann, falls ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Es kommt dabei auf den inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunkt an. Die geänderte Nutzung während der Corona-Pandemie kann dazu führen, dass ein häusliches Arbeitszimmer zum Mittelpunkt der Tätigkeit geworden ist. Insbesondere, falls die Arbeiten im Büro und zu Hause im Arbeitszimmer qualitativ gleichwertig sind. In diesem Fall kommt es nämlich auf die zeitliche Verteilung an. Wer unter diesen Voraussetzungen 2020 mehr Tage zu Hause als im Büro gearbeitet hat, hat Anspruch auf den vollen Abzug der Arbeitszimmerkosten. Je Woche drei Tage Homeoffice und zwei Tage Arbeit im Büro können also ausreichen, um die Kosten für ein Arbeitszimmer in voller Höhe abzusetzen – solange die Arbeit im Büro qualitativ nicht höherwertiger ist als die Arbeit zu Hause. Das kann insbesondere bei Selbständigen der Fall sein. Bei Arbeitnehmern ist hingegen zumeist der Betrieb des Arbeitgebers der qualitative Mittelpunkt der Tätigkeit. Ob das in Ihrem Fall zu einer erhöhten Absetzbarkeit von Aufwendungen führt, prüfen wir gerne. |
|
|
| |
Firmenwagen: Wann lohnt die pauschale 1 %-Methode?Bei Firmenwagen, die auch privat genutzt werden können, stellt sich regelmäßig die Frage, ob die 1 %-Methode oder das Fahrtenbuch die bessere Wahl ist. Nach unserer Erfahrung kommt es dabei immer auf den Einzelfall an bzw. wie hoch die Privatnutzung ausfällt.
Grundsätzlich gilt: Nur bei Firmenwagen, die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden und damit zum notwendigen Betriebsvermögen gehören, darf der Privatanteil durch die pauschale 1 %-Methode ermittelt werden. Zur betrieblichen Nutzung zählen auch die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte sowie Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Keines weiteren Nachweises bedarf es daher, falls diese Fahrten bereits mehr als 50 % der Jahreskilometerleistung des Firmenwagens ausmachen. Andernfalls ist (auf Nachfrage des Finanzamts) der Umfang der betrieblichen Nutzung glaubhaft zu machen. Dies kann in jeder geeigneten Form auch über einen repräsentativen Zeitraum erfolgen. Ein Fahrtenbuch ist nicht erforderlich. Sofern wir Ihre Fahrzeugkosten für 2020 kennen und Sie ein Fahrtenbuch geführt haben, können wir alternativ den Nutzungswert nach der sog. Fahrtenbuch- Methode berechnen. So sehen wir auf einen Blick, ob sich ein Einzelnachweis bezahlt macht. In den folgenden Fällen lohnt sich die Mühe nahezu immer:
Beachten Sie: Nutzen Freiberufler und Gewerbetreibende einen Firmenwagen für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte, sind bei Anwendung der 1%-Regelung eine Pauschale in Höhe von 0,03 % des inländischen Listenpreises pro Monat für jeden Entfernungskilometer als nicht abziehbare Betriebsausgaben anzusetzen. Bei Arbeitnehmern ist entsprechend ein geldwerter Vorteil als Arbeitslohn zu erfassen. Unser Rat: Sollten Sie in 2020 wegen der Corona-Pandemie viel im Homeoffice gearbeitet haben, kommt alternativ eine Einzelbewertung der Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte bzw. erster Tätigkeitsstätte mit 0,002 % des Listenpreises je Entfernungskilometer in Betracht. Das Verfahren kann aber nur für das gesamte Jahr einheitlich angewendet werden. Konnte ein Firmen- oder Dienstwagen während eines vollen Kalendermonats nicht für die Fahrten zur Arbeit genutzt werden (z. B. bei einer kompletten Schließung des Betriebs), kann dieser Monat sogar ganz außen vor bleiben. Arbeitnehmer können im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung die Einzelbewertung auch dann wählen, sofern der geldwerte Vorteil in den Gehaltsabrechnungen nach der 0,03 %-Regelung lohnversteuert wurde. |
|
|
| |
Ehegattenarbeitsvertrag: Fremdüblichkeit bei ZusatzleistungenArbeiten Familienangehörige in Ihrem Betrieb mit, dann wird Sie dieses Thema besonders interessieren. Zur Flexibilisierung der Berufswelt können Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter sog. Wertguthaben vereinbaren. Im Kern geht es darum, künftig fällig werdenden Arbeitslohn auf ein Wertguthabenkonto einzubezahlen, um ihn später im Zusammenhang mit einer vollen oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des noch fortbestehenden Arbeitsverhältnisses auszubezahlen.
Die entsprechenden Einstellungen in das Wertguthaben lösen keine Beitragspflicht zur Sozialversicherung aus und unterliegen zunächst auch nicht der Lohnsteuer, da dem Arbeitnehmer noch kein Arbeitslohn zufließt. Diese Möglichkeit besteht auch im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zwischen Eheleuten. Allerdings muss hierbei besonders darauf geachtet werden, dass der sog. Fremdvergleich im Steuerrecht erfüllt wird. Darauf legen nicht nur die Finanzämter größten Wert, sondern auch der BFH. Dazu heißt es in einem aktuellen Urteil: Wesentliches Indiz für die Fremdüblichkeit ist, wie die Vertragschancen und -risiken verteilt sind. Eine einseitige Verteilung zu Lasten des Arbeitgeber-Ehegatten ist regelmäßig anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer-Ehegatte unbegrenzt Wertguthaben ansparen sowie Dauer, Zeitpunkt und Häufigkeit der Freistellungsphasen nahezu beliebig wählen kann. In dem zugrunde liegenden Fall arbeitete die Ehefrau im Unternehmen ihres Mannes als Bürofachkraft. Vereinbarungsgemäß sollte vom Bruttogehalt in Höhe von 1.410 € ein Betrag von 1.000 € zuzüglich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung in ein Wertguthabenkonto einbezahlt werden. Das Problem: Fremden Arbeitnehmern bot der Unternehmer das Zeitwertguthabenmodell nicht an, sondern machte alternative Angebote zur betrieblichen Altersvorsorge. Im Anschluss an eine Außenprüfung erkannte das Finanzamt die Rückstellung für das Wertguthaben nicht an. Zu Recht, wie der BFH bestätigte und damit die steuerzahlerfreundliche Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg aufhob. Unser Rat: Soll im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsverhältnisses eine zusätzliche Leistung an den Arbeitnehmer vereinbart werden, ist besonderes darauf zu achten, ob dieses Lohn-Extra dem Fremdvergleich standhält. Hierbei sollten Sie unbedingt unsere steuerliche Expertise einholen. Wichtig dabei ist: Gibt es weitere Mitarbeiter, die zumindest ähnliche Tätigkeiten wie der Ehepartner des Betriebsinhabers ausüben, müssen hinsichtlich der Zusatzleistungen alle gleichbehandelt werden. |
|
|
| |
Jobticket steuerfrei trotz Gehaltsumwandlung?Gibt es für Ihre Mitarbeiter auch ein Parkplatzproblem bei der Fahrt zum Arbeitsplatz? Findige Finanzrichter aus Hessen haben hierzu ein erstaunliches Mobilitäts-Urteil gefällt. Zum Hintergrund: Erwerben Sie bei einem Verkehrsträger Tickets und überlassen sie diese Ihren Mitarbeitern unentgeltlich oder vergünstigt, sehen die steuerlichen Folgen bislang so aus: Der Sachbezug bleibt steuerfrei, sofern der Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht wird. Allerdings wird beim Arbeitnehmer die Entfernungspauschale gekürzt (max. bis
auf null). Die Steuerfreiheit gilt auch für Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Fahrberechtigungen, die die Mitarbeiter selbst erwerben. Wird die Zusatzleistung durch Gehaltsumwandlung erbracht, können Sie eine Pauschalversteuerung in Höhe von 25 % vornehmen. Eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale entfällt dann. Alternativ ist auch eine Pauschalsteuer von 15 % möglich, was aber wieder zur Kürzung der Entfernungspauschale beim Arbeitnehmer führen würde. Jetzt der Paukenschlag: Nach einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts stellt die Überlassung eines Jobtickets im Rahmen einer sog. Mobilitätskarte, die in erster Linie auf die Beseitigung der Parkplatznot auf den vom Arbeitgeber unterhaltenen Parkplätzen gerichtet ist, keinen steuerpflichtigen Lohn dar. Begründung der Richter: Das Jobticket stelle keine Prämie oder Belohnung für eine Arbeitsleistung dar, die der Arbeitnehmer für den Arbeitgeber erbringe. Vielmehr habe der Arbeitgeber die Mobilitätskarte angeboten, um die Beschäftigen zur Nutzung des ÖPNV zu motivieren und so die angespannte Parkplatzsituation zu entschärfen. Dass diese Maßnahme für die Beschäftigten das verbilligte Jobticket als positiven Reflex nach sich ziehe, spiele keine entscheidende Rolle. Im Übrigen seien auch die Parkplätze kostenfrei zur Verfügung gestellt worden, ohne dass dies eine Lohnversteuerung nach sich gezogen hätte. Unsere Einschätzung: Dieser praxisnahe Richterspruch hat erhebliche Auswirkungen, da er wesentlich mehr Möglichkeiten zur Gewährung von Jobtickets ermöglicht. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Einräumung der Steuerfreiheit bei zusätzlicher Gewährung eines Tickets zum Lohn – ebenso wie mit der Überlassung eines Firmenfahrrads – ein umweltpolitisch sinnvolles Ziel verfolgt. Die Praxis zeigt aber, dass die Hürden hierfür finanziell oft zu hoch sind. Stattdessen vereinbaren viele Unternehmen mit Verkehrsbetrieben Rabatte auf Firmentickets für ihre Mitarbeiter. Vor diesem Hintergrund hat das Hessische FG einen sehr praxisrelevanten Fall ganz im Sinne von Firmen und Mitarbeitern entschieden. Es bleibt abzuwarten, ob der BFH die Nichtzulassungsbeschwerde des Finanzamts aufgreift oder abschmettert. Eine positive höchstrichterliche Rechtsprechung wäre auf jeden Fall wünschenswert. |
|
|
| |
Richtsatzsammlung: Fiskus legt endlich Zahlen für 2019 vorUm bei Gewerbetreibenden die Angaben zum Umsatz bzw. Gewinn zu überprüfen, greift der Fiskus auf die Richtsatzsammlung zurück. Dort sind etliche Kennziffern
(Roh-, Halbrein- und Reingewinn) zusammengefasst, mit denen Ihr Unternehmen einem Branchenvergleich ('Normbetrieb') unterzogen wird. Mit viel Verspätung hat das BMF (www.bundesfinanzministerium.de – Stichwort: „Richtsatzsammlung 2019“) für mehr als 70 Gewerbeklassen von 'Ambulante soziale Dienste' bis 'Zimmerei' die Zahlen für 2019 bekanntgegeben. Sofern gegenüber der amtlichen Richtsatzsammlung deutliche Abweichungen vorliegen, muss fast jeder Unternehmer bei einer Betriebsprüfung mit Nachfragen rechnen. Bei unvollständiger Buchführung bilden die Normwerte meist auch die Basis für eine Umsatz- oder Gewinnschätzung. Ist die Buchführung dagegen formell ordnungsgemäß, darf eine Schätzung nicht allein auf die Abweichungen gestützt werden. Allerdings muss es plausible Gründe für Differenzen geben, die mit Besonderheiten des Betriebs in Zusammenhang stehen (z. B. Schadens-ereignisse, Diebstahl etc.). Auf der anderen Seite müssen wir auch der Gegenseite stets klarmachen, dass die Werte in der Richtsatzsammlung keineswegs repräsentativ und transparent sind. So ist z. B. die Datenbasis unbekannt und Betriebe mit Verlusten werden gar nicht berücksichtigt. Zudem sind die Zahlen teilweise schon mehrere Jahre alt. Deshalb kann es in begründeten Fällen auch angezeigt sein – ggff. auch schon während einer Betriebsprüfung – das Finanzamt aufzufordern, die Gültigkeit und Aktualität der Daten nachzuweisen. Zudem wird die Richtsatzsammlung auch in Steuerstrafverfahren herangezogen. So weist der BGH darauf hin, dass – sofern andere Schätzungsmethoden nicht in Betracht kommen – die Besteuerungsgrundlagen gemäß der Richtsatzsammlung pauschal geschätzt werden dürfen. Da es sich jedoch um ein eher grobes Schätzungsverfahren handelt, das auf bundesweiten Prüfungsergebnissen beruht, müssten „die festgestellten Umstände des Einzelfalls, namentlich die örtlichen Verhältnisse und die Besonderheiten des Gewerbebetriebs“ berücksichtigt werden. |
|
|
| |
Steuerentlastung für gestresste ElternEine Steuervergünstigung, die durch die Corona-Pandemie erheblich an Bedeutung gewonnen hat, ist der Sonderausgabenabzug von Betreuungskosten für Kinder, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Eltern können zwei Drittel ihrer Kosten für die Betreuung von steuerlich zu berücksichtigenden Kindern, die nicht älter als 13 Jahre alt sind, als Sonderausgaben geltend machen. Maximal sind 4.000 € pro Kind und Jahr abzugsfähig. Bei jährlichen Kosten von 6.000 € je Kind werden die Steuervorteile somit voll ausgeschöpft. Für ältere Kinder ab 14 Jahren können Eltern die Kosten für eine Betreuung im Haushalt
(z. B. durch eine Kinderfrau, Tagesmutter oder ein Au-Pair-Mädchen) unter bestimmten Voraussetzungen als haushaltsnahe Leistungen steuerlich geltend machen. Bei einem Mini-Job sind 20 % der Aufwendungen begünstigt, die Steuerermäßigung beträgt höchstens 510 €, bei Dienstleistungen 20 % der Kosten, maximal 4.000 €. Unser Rat: Auch Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern bei der Elternarbeit unter die Arme greifen. Steuerfrei sind allerdings nur zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen. Erstattet der Arbeitgeber einem Mitarbeiter entsprechende Aufwendungen steuerfrei, ist nach Auffassung der Finanzverwaltung ein Sonderausgabenabzug insoweit nicht möglich. Unser Rat: Ob das rechtens ist, muss der BFH demnächst bentscheiden. In vergleichbaren Fällen werden wir daher Einspruch einlegen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. Als Sonderausgaben sind nur die reinen Betreuungskosten begünstigt, nicht aber die Kosten für Verpflegung. Soweit der Arbeitgeber Verpflegungskosten (z. B. in einer Kita) steuerfrei erstattet, ist es unstreitig, dass keine Anrechnung bei den Sonderausgaben erfolgt. Bei einer entsprechenden Vereinbarung kann daher späterer Ärger mit dem Finanzamt von vornherein ausgeschlossen werden. |
|
| |
Kurz und knapp auf den Punkt gebrachtSachentnahmen
Die Finanzverwaltung hat die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben für 2021 bekanntgegeben (www.bundesfinanzministerium.de – Stichwort: „Eigenverbrauch 2021“). Diese gelten z. B. für Gast- und Speisewirtschaften sowie den Lebensmitteleinzelhandel. Beachten Sie: Soweit Unternehmen wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind, brauchen die Pauschbeträge nur zeitanteilig angesetzt zu werden. Da für Speisen ursprünglich nur bis zum 30.6. der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden ist, gelten laut BMF für das 1. und 2. Halbjahr unterschiedliche Werte. Mit dem Dritten Corona-Steuerhilfegesetz hat der Bundestag jedoch nachträglich die Verlängerung dieser Regelung bis Ende 2022 beschlossen, so dass eine Unterscheidung entbehrlich geworden ist. (Teil-)Eigentumserwerb wird künftig teurer! Der BFH ist ein wandlungsfähiges Gericht. Laut höchstrichterlicher Rechtsprechung gehörte bisher beim Kauf einer gebrauchten Eigentumswohnung (ETW) die gleichzeitig miterworbene Instandhaltungsrücklage nicht zur grunderwerbsteuerpflichtigen Gegenleistung. Vor fast fünf Jahren machten die obersten Steuerrichter aber eine Einschränkung. Sie entschieden, dass beim Erwerb einer ETW im Wege der Zwangsversteigerung das Meistgebot als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrücklage zu mindern ist. Das Finanzgericht Köln ging dann in einem fiskalfreundlichen Urteil einen Schritt weiter. Die Instandhaltungsrücklage unterliege auch beim 'normalen' Kauf der Grunderwerbsteuer, sagten die Kölner Richter. Wegen grundsätzlicher Bedeutung wurde die Revision damals zugelassen. Leider ist der Musterprozess beim BFH nun zugunsten des Fiskus ausgegangen. In ihrem neuen Urteil halten die Richter nicht mehr an ihrer alten Sichtweise fest. Nunmehr gilt: „Beim rechtsgeschäftlichen Erwerb von Teileigentum ist der vereinbarte Kaufpreis als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern.“ Beträgt die Rücklage z. B. 20.000 €, bedeutet dies bei Steuersätzen von 3,5 % bis 6,5 % — je nach Bundesland — eine Mehrbelastung von 700 € bis zu 1.300 €. Unser Rat: Trotz dieser Entscheidung gibt es weiterhin Möglichkeiten, wie sich die Grunderwerbsteuer reduzieren lässt. Denn Haus-Zubehör ist nicht grunderwerbsteuerpflichtig. Das gilt z. B. für
gesondert aufzulisten. Hierfür gibt es eine Verwaltungsregel, wonach der vereinbarte Wert für das Zubehör als angemessen gilt, sofern er 15 % der Gesamtgegenleistung, höchstens jedoch 50.000 €, nicht übersteigt. Möglich ist zudem, die Aufteilung der Gesamtgegenleistung nach der sog. Boruttau'schen Formel vorzunehmen, wonach das Gesamtentgelt mit dem gemeinen Wert der Grundstücke zu vervielfachen und durch die Summe des gemeinen Werts der sonstigen Gegenstände und des gemeinen Werts des Grundstücks zu teilen ist. Sie sollten daher vor Abschluss eines notariellen Vertrags unsere Expertise einholen. |
|
| |
Steuertermine April 2021Bitte reichen Sie für die folgenden Steuerarten frühzeitig Ihre Unterlagen bei uns ein!
Scheck*/bar: Montag, 12. April Banküberweisung: Donnerstag, 15. April * Scheck muss spätestens 3 Tage vor Fälligkeit dem Finanzamt vorliegen! |
|
| |
|
| |
| |
Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. |
|
|
|||||
|
|||||
|
| |
|
| |||
|